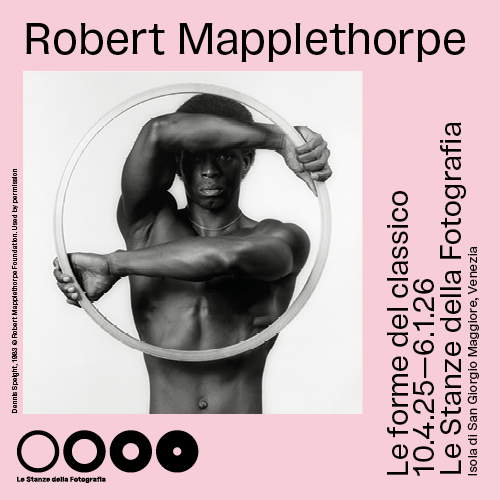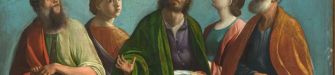Josef Hoffmann, Architekt des 20. Jahrhunderts, der Design in den Alltag brachte
EinGesamtkunstwerk: Das war das Grundprinzip der Wiener Werkstätte, einer künstlerischen Bewegung, die 1903 von dem Architekten Josef Hoffmann (Brtnice, 1870 - Wien, 1956) und dem Maler Koloman Moser unter Mitarbeit des Industriellen FritzWärndorfer gegründet wurde. Hauptziel war es, nach dem Vorbild der englischen und schottischen Arts-and-Crafts-Bewegung Gegenstände von hohem ästhetischen und künstlerischen Wert in das Alltagsleben zu bringen. Letztere verbreitete sich dank John Ruskin und Wiliam Morris in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in weite Teile des 20. Jahrhunderts und wurde von Künstlern, Architekten und Designern sowie Philanthropen unterstützt, die dieEinheit der Künste, die Erfahrung des einzelnen Handwerkers und die Qualität der für die Herstellung des Werks selbst verwendeten Materialien förderten. Im Gegensatz zur industriellen Welt wurden kleine Werkstätten gegründet. Die Wiener Werkstätte, wie der Name schon sagt (Wiener und Werkstätte), basiert ebenfalls auf der Produktion in spezialisierten Werkstätten.
Nach dem Vorbild des Kunstgewerbes betrachteten die Gründer der Wiener Werkstätte, die bis 1932 tätig war, Design als eine Synthese von Kunst und Handwerk im Alltag. Der Kunstbegriff wurde also neu definiert, um daskünstlerische Handwerk und die handwerkliche Geschicklichkeit wieder in den Vordergrund zu rücken: Es entstanden hochwertige Gegenstände des täglichen Lebens, wie Möbel, Porzellan, Glas, Schmuck und Mode. Schlichte, praktische und zugleich raffinierte und elegante Gegenstände stehen im Gegensatz zu Objekten, die sich stets am Stil der Vergangenheit orientieren: Die figurativen Künstler leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der Moderne. Die 30-jährige Tätigkeit der Wiener Werkstätte war jedoch von ständigen wirtschaftlichen Problemen geprägt, die 1932 in ihrer endgültigen Schließ ung aufgrund der allgemeinen Verarmung des Wiener Bürgertums, dem Hauptabnehmer dieser Objekte, gipfelten. Das Archiv der Wiener Werkstätte befindet sich heute im MAK - Museum für angewandte Kunst in Wien und umfasst 16.000 Skizzen, 20.000 Textilmuster, Plakate, Entwürfe für Ansichtskarten, Kataloge, Fotoalben und Geschäftskorrespondenz. Darüber hinaus verfügt das Museum über eine große Sammlung von Objekten aus allen Schaffensphasen der Kunstbewegung, darunter die weltweit größte Sammlung von Möbeln, Objekten und Entwürfen von Josef Hoffmann. Das Verdienst der Wiener Werkstätte bestand darin, dass sie die Ausbreitung der Jugendstilornamentik des belgischen und französischen Stils zugunsten von Funktionalität und einfachen, geometrisch-abstrakten Formen im gesamten Kunsthandwerk des 20. Jahrhunderts überwunden hat. Jahrhunderts. Es kam zu einer Erneuerung der Kunst auf der Grundlage desHandwerks: Wien wurde so zum Zentrum der Geschmackskultur im Bereich der angewandten Kunst.








Einer der Begründer der Bewegung war, wie bereits erwähnt, der Architekt und Designer Josef Hoffmann. Der 1870 in Pirnitz, Mähren, geborene Hoffmann begann 1892 ein Architekturstudium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. In der österreichischen Hauptstadt war er Schüler von Otto Wagner, dessen Vorstellung von der Funktion des Architekten er teilte: Der Architekt musste über die Kunst des Bauens hinausgehen; er musste ein Gestalter sein, der in der Lage war, auch die Details, die kleinsten Elemente zu gestalten, um ein harmonisches Ganzes zu schaffen. 1897 gründete Hoffmann zusammen mit einer Gruppe von Künstlern, zu denen Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich und Carl Moll gehörten, in Polemik gegen die akademische Welt die Wiener Sezessionsbewegung . Für die Zeitschrift der Sezession, Ver Sacrum, fertigt er Illustrationen und dekorative Friese an. Sechs Jahre später, 1903, gründete er mit seinem Freund Koloman Moser und der Unterstützung von Fritz Wärndorfer die Wiener Werkstätte, die bald zu einem Zentrum der Gestaltung wurde. Es galt, von der industriellen Massenproduktion wegzukommen: “Besser zehn Tage an einem Produkt arbeiten als zehn Produkte an einem Tag herstellen”, dachte er.
Unter den Protagonisten der Wiener Moderne spielte Josef Hoffmann eine grundlegende Rolle in der österreichischen und ausländischen Kunstszene, sowohl für sein Konzept des Gesamtkunstwerks, ein Begriff, der erstmals 1827 von dem Schriftsteller und Philosophen Karl Friedrich Eusebius Trahndoff in einem seiner Aufsätze verwendet wurde, als auch später von Richard Wagner , der ihn mit einbezog Letzterer betrachtete das Theater der griechischen Antike als Ausdruck des Gesamtkunstwerks, d. h. eines Theaters, in dem Musik, Schauspiel, Choreographie, Poesie und bildende Kunst zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen. Das Ideal des Gesamtkunstwerks wurde von den figurativen Künstlern der Wiener Werkstätte propagiert, die eine idealisierte Verschmelzung der verschiedenen Künste in Alltagsgegenständen vorschlugen.
Als Architekt entwarf Josef Hoffmann unter anderem das Sanatorium Purkersdorf (1904/05), das Palais Stoclet in Brüssel (1905-1911), die Kunstschau in Wien (1908), den österreichischen Pavillon für dieWerkbundausstellung in Köln (1914), der Pavillon für dieInternationale Ausstellung moderner dekorativer und industrieller Kunst in Paris (1925), die Werkbundsiedlung in Wien (1931) und der Pavillon für die Biennale in Venedig 1934. Für die Pariser Weltausstellung 1937 schuf er das Boudoir d’une grande vedette, bestehend aus einem Schlafsofa und einem Sessel aus vergoldetem Stoff mit Blattwerkmotiven und einem kleinen niedrigen Tisch mit Glasplatte. Im Jahr 1924 hingegen entwirft er die Möbel für die Villa von Sonja Knips, Baronin von Poitiers des Eschelles und Ehefrau des Industriellen Anton Knips, der eine sehr wichtige Rolle in der Moderne spielte. Neben verschiedenen Bauten und Renovierungen gab Hoffmann die Villa Knips in Auftrag, die als die letzte vom Architekten entworfene Stadtvilla mit Bezügen zum künstlerischen und ornamentalen Biedermeierstil gilt.




Das 1904-1905 für Victor Zuckerkandl, Generaldirektor der schlesischen Eisenwerke in Gleiwitz, errichtete Sanatorium Westend in Purkersdorf gilt als herausragendes Beispiel für die Architektur der Wiener Secession. Es wurde von einem Sanatorium in eine Art Hotel umgewandelt, ein Treffpunkt für die künstlerischen und intellektuellen Exponenten Wiens: Arthur Schnitzler, Egon Friedell, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Hugo von Hoffmannsthal und Koloman Moser waren häufige Gäste. Auch das Palais Stoclet gilt als eines der architektonischen Meisterwerke Hoffmanns und der Wiener Secession: Das seit 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Gebäude wurde zwischen 1905 und 1911 im Auftrag des Bankiers und Kunstsammlers Adolphe Stoclet in Brüssel errichtet. Das Gebäude ist ein Zeugnis der künstlerischen Erneuerung in der europäischen Architektur und bewahrt einen Großteil seiner ursprünglichen Ausstattung. Mit Werken von Koloman Moser, Gustav Klimt (sein berühmtes Fries mit demLebensbaum, demWartenden und derUmarmung), Frantz Metzner, Richard Luksch und Michael Powolny, die das Innere des Gebäudes schmücken, verkörpert es voll und ganz das Konzept eines Gesamtkunstwerkes.
Josef Hoffmann war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Kunstszene und insbesondere der architektonisch-dekorativen Szene, die in der Lage war, elegante und raffinierte Werke und Objekte zu schaffen und eine künstlerische Bewegung ins Leben zu rufen, die für das Design des 20. Jahrhunderts grundlegend war. Eine Figur, die es verdient, sowohl aus künstlerischer als auch aus kulturhistorischer Sicht des frühen 20. Jahrhunderts in Wien eingehend untersucht zu werden.
Um mehr über die Kunst von Josef Hoffmann, dem schönheitsliebenden Designer, zu erfahren , besuchen Siehttps://www.austria.info/it/arte/artisti-e-capolavori/josef-hoffmann
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.