Wenn die Biennale von Venedig zu einer Fotosafari unter Außenseitern wird. Die Grenzen der Ausstellung von Pedrosa
Genau fünfzig Jahre sind vergangen, seit ein “Initiativkomitee für naive Malerei auf der Biennale von Venedig” einen leidenschaftlichen Brief an Carlo Ripa di Meana schrieb, der gerade zum Präsidenten der kürzlich reformierten Biennale ernannt worden war, in dem es die Institution um die volle Anerkennung der naiven Bewegung bat, die vielleicht durch die Präsenz einer “naiven” Ausstellung in der Ausstellung sanktioniert werden sollte, die denjenigen gewidmet war, die jahrelang von den meisten Kritikern geächtet, aus den noblen Kreisen ausgeschlossen, oft sogar verspottet worden waren, die aber dennoch in der Lage waren, die Welt zu durchdringen.eine Ausstellung, die jenen “Naivlingen” gewidmet ist, die jahrelang von den meisten Kritikern geächtet, aus adligen Kreisen ausgeschlossen, oft sogar verspottet wurden, die aber dennoch auf dem Markt zu wüten vermochten, und die mit sonniger Anschaulichkeit die Annahme verkörpert, dass die Geschichte der Kunst und die Geschichte des Geschmacks oft auf fernen Wegen verlaufen. Es war im Frühjahr 1974: “Wir sind sicher”, schrieb der Ausschuss an Ripa di Meana und den Vorstand, “dass die Bedeutung des historischen Phänomens der ’neuen Phantasie’ keinem von Ihnen entgangen sein wird: Das Wachstum einer Bewegung, die als naive Kunst bezeichnet wird, ist quantitativ und qualitativ ein neues Faktum in der Entwicklung der Sensibilität immer größerer Massen, der so genannten neuen Energien unserer Zeit. Wir haben es nicht mehr mit Blitzen außerakademischer oder primitiver oder populärer Phantasie zu tun [...]. Wir haben es mit einer Bewegung zu tun, die nicht mehr aufhören und wachsen wird, auch unter den gegenwärtig schwierigen Bedingungen der Volkskultur und dem komplizierten Verhältnis zu den Künsten und dem ästhetischen Bewusstsein der Volksmassen. Gerade wegen dieses präzisen und festen Bewusstseins bitten wir Sie, der neuen naiven Malerei konkret den vollen kulturellen Status, die professionelle Würde und den künstlerischen Respekt zuzugestehen, der ihr gegen jede elitäre oder untergeordnete Auffassung von Kultur zusteht”. Die Unterzeichner dieses Briefes konnten nicht ahnen, dass zu einem runden Jahrestag, im Jahr 2024, Legionen von Folk- und Brut-Künstlern aus der ganzen Welt endlich auf der wichtigsten Ausstellung der Welt ausgestellt werden würden und dass die begehrte institutionelle Aufnahme der “marginalisierten” Kunst Der Kurator der 60. Biennale, Adriano Pedrosa, tut sich schwer damit, dies als Anerkennung zu sehen, und zieht es vor, wenn auch nur implizit, zu glauben, dass die hypertrophe Berufung von indigenen, queeren und Außenseiterkünstlern zu seiner Biennale, wenn überhaupt, die friedliche Konsequenz einer Art natürlichem Verlauf der Kunstgeschichte ist.
In gewisser Weise hat Pedrosa Recht, wenn er in seinem im Katalog veröffentlichten Interview mit Julieta González erklärt, dass es für einen europäischen oder amerikanischen Besucher ziemlich einfach ist, zeitgenössische Künstler aus dem, wie er es nennt, “globalen Süden” zu erkennen, da “seit den späten 1990er und frühen 2000er Jahren zeitgenössische Künstler aus unserem Teil der Welt eine größere Sichtbarkeit erlangt haben: Wenn nicht alle, so doch zumindest einige von ihnen reisen und stellen in Museen, Galerien und auf Biennalen aus”. In Italien spüren wir das vielleicht weniger, da unsere Museen für zeitgenössische Kunst meist eine andere Ausrichtung haben, aber es genügt, die wichtigsten Messen zu besuchen, um sich der Unmengen an afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Kunst bewusst zu werden, die von so vielen Galeristen angeboten werden, die zwangsläufig einen Geschmack und ein Interesse auffangen, das seit mindestens zwei Jahrzehnten und mit zunehmender Konstanz den Appetit von Sammlern aus der ganzen Welt weckt, und in diesem Sinne sind die Italiener keine Ausnahme. Foreigners everywhere - Fremde überall, die internationale Ausstellung der Biennale 2024, bietet daher keine nennenswerten Neuerungen (auch die Aufsätze, aus denen der Katalog besteht, sind - abgesehen von dem einzigen unveröffentlichten Beitrag von Claire Fontaine - eine Sammlung von Artikeln, die zwischen 1998 und 2023 veröffentlicht wurden): sollte, wenn überhaupt, einerseits als ein Moment der offiziellen Weihe für Künstler gelesen werden, die seit Jahren auf dem Markt präsent sind, sogar mit ausgesprochen hohen Quoten, und andererseits als ein Mittel, um Diskussionen zu verstärken, die bereits seit einiger Zeit im Gange waren, als ein Mittel, um den Besuchern der Biennale Künstler zu liefern, die andere Institutionen in den vorangegangenen Jahren dem europäischen und amerikanischen Publikum nahegebracht hatten. Im Arsenale wird das Programm mit Claire Fontaine und Yinka Shonibare eröffnet, Künstlern, die den Besuchern der zeitgenössischen Kunst gut bekannt sind.Der Diskurs über die zeitgenössische Kunst, die von zwei führenden Galerien (der Pariser Mennour und der New Yorker Goodman) vertreten wird, ließe sich jedoch auf einen entschiedenen Teil, vielleicht sogar auf die Mehrheit der lebenden Künstler in der Ausstellung ausdehnen, die auf einem Markt, der von weißem, eurozentrischem Geld dominiert wird, gut vertreten sind, unabhängig davon, ob es sich um Autodidakten oder populäre Künstler handelt, oder im Gegenteil um Künstler mit einem traditionellen, formalen, akademischen Hintergrund: Frieda Toranzo Jaeger (vertreten durch die Barbara Weiss Gallery), Emmi Whitehorse (Garth Greenan), Greta Schödl (Labs Gallery), Julia Isídrez (Gomide&Co), Dana Awartani (Lisson), und so weiter. Selbst die Ureinwohnerin Naminapu Maymuru-White, die “große alte Yolnu”, wie sie uns in den Bildunterschriften der Ausstellung vorgestellt wird, hat ihre Interessen einer der führenden Galerien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum anvertraut (der australischen Sullivan+Strumpf, die zu den Stammgästen der Art Basel gehört).
Das Gleiche gilt natürlich auch für die Sektion im zentralen Pavillon der Giardini, wo unter anderem Louis Fratino zu finden ist, einer der Künstler, die derzeit vom Markt am meisten gepusht werden (in einem merkwürdigen und bizarren Dialog mit Filippo de Pisis auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Homosexualität, zumindest wenn man die Bildunterschriften liest), oder der gebürtige Kay Walkingstick, der mit seiner Galerie nur eine Ausstellung auf der letzten Art Basel Miami hatte.oder die einheimische Aycoobo, die bei der letzten Art Basel Miami nur eine Ausstellung mit ihrer Galerie hatte, oder sogar die einheimische Aycoobo, die bei der Toronto Biennale 2022 einen Preis gewann, während die meisten der nicht lebenden Künstler (die die Mehrheit der Namen in dieser Biennale ausmachen) auf jeden Fall bereits in großen Ausstellungen gezeigt wurden, vom MoMA in New York bis zur Tate in London über viele der großen internationalen Museen für zeitgenössische Kunst. Und wenn man sich einen Pedrosa vorstellt, der auf der Suche nach den Werken der Yanomami-Schamanen durch den Amazonas-Regenwald wandert, um dem europäischen Publikum Bilder zu zeigen, die in unseren Breitengraden noch nie zu sehen waren, wird man enttäuscht sein: Die Werke von André Taniki und Joseca Mokahesi touren seit mindestens zwanzig Jahren durch die Museen unseres Kontinents, wobei die Fondation Cartier 2003 mit der Ausstellung Yanomami. L’esprit de la forêt (Der Geist des Waldes). Kurzum, wo sind diese Ausgestoßenen, diese vom System Ausgegrenzten?




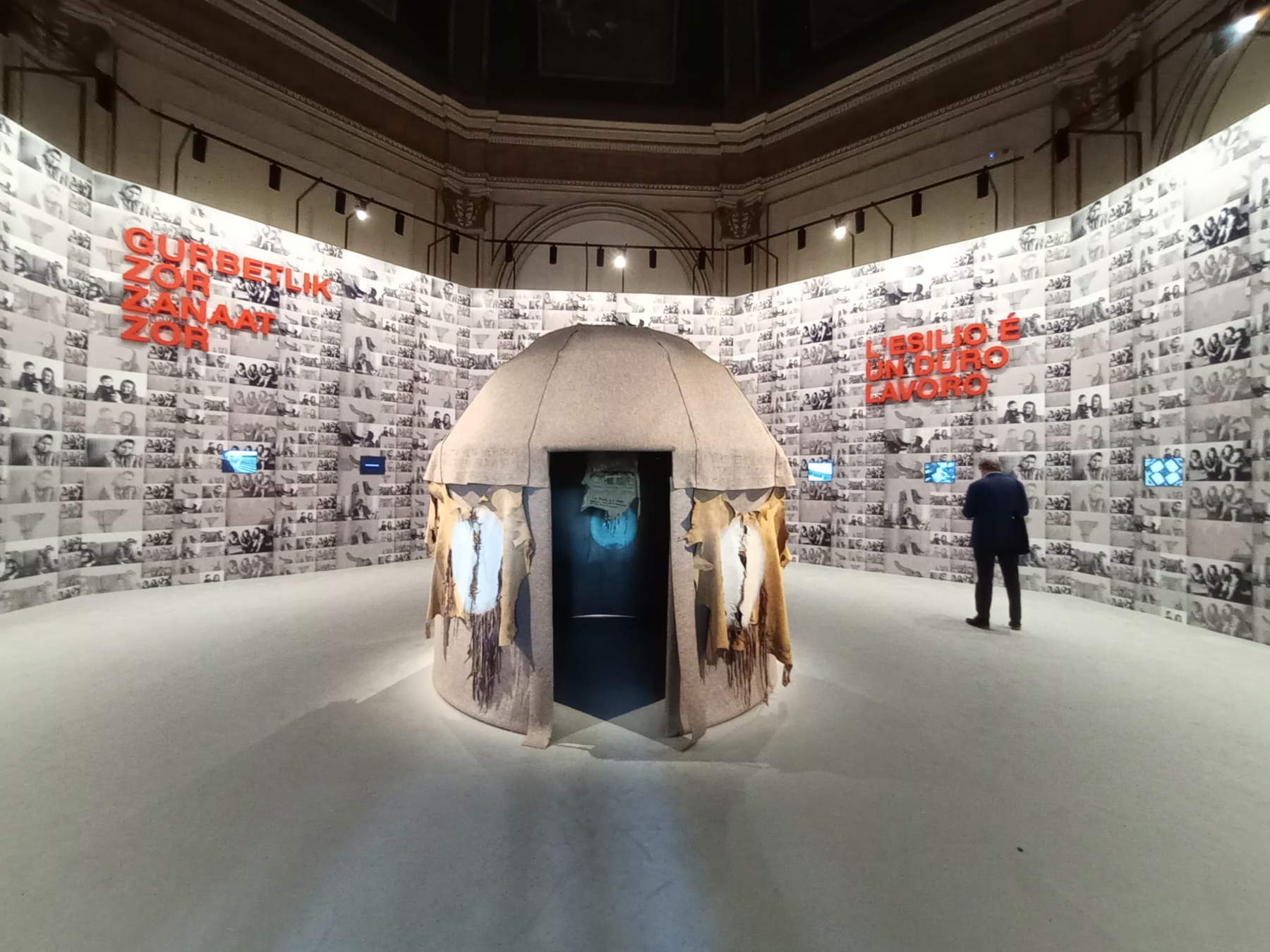

Die erste Konsequenz ist also eine Art Rückkehr des Kolonialismus, der bereits die Atmosphäre der letzten Ausgabe der internationalen Ausstellung, Il latte dei sogni (Die Milch der Träume ) von Cecilia Alemani, einhüllte und der jedoch in einer Ausgabe, der aktuellen, die das Thema der Dekolonisierung in den Mittelpunkt stellen will, zu einem unausweichlichen Thema wird. Der einzige, der das Thema nicht scheut, ist Ticio Escobar in seinem im Katalog veröffentlichten Essay, in dem er betont, dass “populäre” Künstler “das Recht haben, alle Kanäle und Institutionen (mit denen sich die dominante Kultur unterbricht und einmischt) zu nutzen und sie als Zufluchtsorte, Schützengräben oder sogar als Landebahnen für potenzielle Flüge zu verwenden”.Aus diesem Grund “kann man die Entscheidung, auf den Markt zurückzugreifen und für gerechtere Preise und eine stärkere Anerkennung der Kreativität des Volkes zu kämpfen, nicht kritisieren”. Diese Feststellung ist mehr als zutreffend, aber sie wirft eine Reihe von Fragen auf, die nicht weniger wichtig sind: Kann ein Künstler, der von einer der mächtigsten Galerien der Welt unter Vertrag genommen wird und der seine Werke in die institutionellsten Kontexte des zeitgenössischen Kunstuniversums einbringt, wirklich als “ausgeschlossen” bezeichnet werden? Inwieweit kann das Narrativ, auf dem diese Biennale aufbaut, dann noch aufrechterhalten werden? Inwieweit können wir die Kunst eines Schamanen, der die letzten Jahre damit verbracht hat, zwischen Paris, London und Shanghai zu pendeln, als unbewusst betrachten? Besteht nicht die Gefahr, dass diese populäre Kreativität ins Gegenteil umschlägt? Der Schamane hat natürlich jedes Recht, sich auf den europäischen und nordamerikanischen Markt zu begeben, um wirtschaftliche, kulturelle und soziale Anerkennung zu erlangen (der Traum vieler Außenseiter ist ja gerade die offizielle Anerkennung), aber gleichzeitig hat auch das Publikum jedes Recht, die Auswirkungen der Operation zu hinterfragen, sich einige Fragen über die Spontaneität eines Künstlers zu stellen, der sich seit Jahren mit dem westlichen Markt misst, über seinen wirklichen Grad der Ausgrenzung, über den wahren Grund seiner Anwesenheit: Ist er hier, weil wir wirklich an dem interessiert sind, was er zu sagen hat, und vielleicht sogar an den Bedingungen seiner Gemeinschaft, oder ist er hier, weil wir ihn als Kuriosität ausstellen, die wir später vergessen werden, wenn wir es leid sind, die Handwerkskunst seiner Hände zu bewundern, die nie moderne westliche Werkzeuge berührt haben? Schon zur Zeit der Naïf-Explosion stellte Giancarlo Marmori in einem seiner denkwürdigen Artikel fest, dass “ein Naïf, einmal entdeckt, nicht lange ignorieren kann, dass er einer ist”, und dass “ein Naïf heute kaum noch eine Chance auf ein heimliches, authentisches und gelassenes Leben hat”: Das galt Mitte der 1970er Jahre, als Marmori seinen Beitrag in L’Espresso schrieb, und gilt heute umso mehr, in der Welt nach der Globalisierung, im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien, und mit einemKunstpublikum , das daran gewöhnt ist, eine Woche nach Venedig, die nächste nach New York, die nächste nach Seoul zu reisen.
Sicherlich sind einige der Künstler oder Projekte, die Pedrosa für seine Ausstellung ausgewählt hat (die sich im Gegensatz zur letzten Ausgabe der internationalen Ausstellung durch eine größere Klarheit, ein saubereres Layout und eine unmittelbarere Frische auszeichnet), in der Lage, das Publikum zu überraschen, vor allem wenn man sie nicht kennt: Man ist dann wirklich beeindruckt von der visionären Kraft von Santiago Yahuarcani, einem autodidaktischen Maler aus dem Volk der Uitoto, der mit seinen Werken inmitten der verworrenen Wälder, Schutzgeister und Tiere seines Amazonasgebiets an die universellen Urteile unserer Kirchen des 13. und 14. Jahrhunderts erinnert. Wir sind bewegt von den Geschichten nigerianischer Motorradtaxifahrer, die Karimah Ashadu in einem ehrlichen Video erzählt. Berührend sind die Textilien der türkischen Künstlerin Günes Terkol, die mit ihren Stoffen aktuelle Ereignisse in eine Geschichte verwandelt, die fast keine zeitliche Dimension zu haben scheint, und die Polyphonie weiblicher Stimmen zum Leben erweckt, in die wir uns sofort einfühlen. Den aufgeräumten Fotografien der Angolanerin Kiluanji Kia Henda gelingt es, auf wirkungsvolle und poetische Weise zu vermitteln, was Privilegien sind, was die soziale Kluft bedeutet. Für einige Augenblicke wird man von den golden glitzernden Keramikskulpturen von Victor Fotso Nyie, einem jungen Kameruner, der seit einiger Zeit in Faenza lebt und arbeitet, in den Bann gezogen. Man kann sich über die Anerkennung freuen, die diese Ausgabe der Biennale Nedda Guidi zuteil werden lässt, einer bedeutenden Keramikerin, die lange Zeit an den Rand gedrängt wurde und die dennoch in die Ausstellung aufgenommen wurde, nicht so sehr wegen ihrer Pionierrolle auf dem Weg der Veredelung der Keramik, der die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchquert hat, sondern vielmehr, weil sie eine "queere Frau, eine überzeugte Feministin" ist. Auch hier hat man die Gelegenheit, die Schärfe von Projekten wie Marco Scotinis Disobedience Archive oder Pablo Delanos Museum of the Old Colony zu erleben. Abgesehen von diesen und einigen anderen akuten Punkten gilt für Pedrosas Biennale derselbe Kommentar, den Jonathan Jones, der bekannte Kritiker des Guardian, vor acht Jahren für die Ausstellung des indischen Künstlers Bhupen Khakhar (die in dieser Ausgabe der Biennale zu sehen ist) in der Tate in London schrieb: "Warum stellt die Tate Modern einen altmodischen, zweitklassigen Künstler aus, dessen Kunst an die Art von britischen Malern erinnert, die sie nie durch ihre Türen lassen würde?










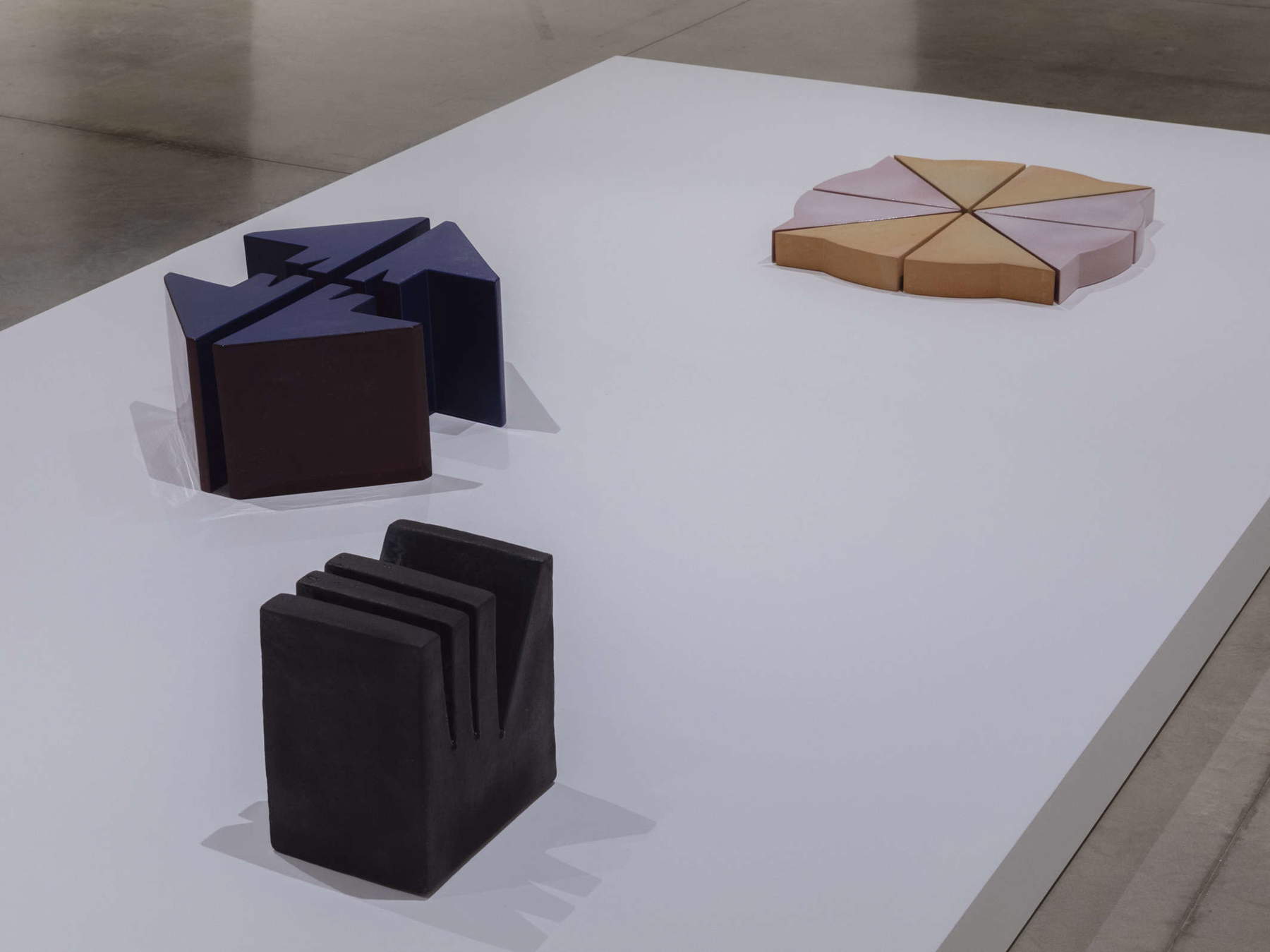

Man könnte Adriano Pedrosa die gleiche Frage stellen, wenn man die große Menge an Außenseiter-, Volks- und Naivkunst in seiner Biennale betrachtet: Was unterscheidet einen autodidaktischen Künstler, der im Amazonas-Regenwald geboren und aufgewachsen ist, von einem der vielen Bauernmaler der Nachkriegs-Emilianer, die nie ein Museum betreten oder ein Buch über Kunstgeschichte in die Hand genommen haben? Was ist der Unterschied zwischen einem Diné-Eingeborenen und einem Hirten aus den Apenninen, der, um Soffici zu zitieren, noch nie den Schnurrbart eines Professors gesehen hat? Welche Eigenschaften haben unsere Ghizzardi, unsere Zinelli, unsere Bolognesi, die nicht zu jener Definition des Außenseiters passen, die Pedrosa im Katalog seiner Ausstellung als "Künstler, der sich am Rande der Kunstwelt befindet, wie der Autodidakt, der Volkskünstler oder der Volkskünstler" wiedergibt? Was für eine Enttäuschung für das Komitee vor fünfzig Jahren: Ausgegrenzt auf der Biennale ja, aber nur, wenn sie exotisch sind. Die einzige Rechtfertigung für den Ausschluss europäischer oder nordamerikanischer Außenseiter (der einzige in der Ausstellung, von dem nicht klar ist, warum, ist der Österreicher Leopold Strobl), abgesehen von der Tatsache, dass ein Italiener, ein Italiener, ein Italiener, ein Italiener, ein Italiener. Abgesehen davon, dass ein Italiener, ein Franzose oder ein Spanier unser mea culpa für den jahrhundertelangen Kolonialismus, dem wir den Rest der Welt unterworfen haben, verwässern würde, liegt die einzige Rechtfertigung für den Ausschluss europäischer oder nordamerikanischer Außenseiter (der einzige, der in der Ausstellung zu sehen ist, ist der Österreicher Leopold Strobl) wahrscheinlich in dem besonderen Gewicht, das die irreguläre Kunst, die Volkskunst in der Ökonomie der Kunst aus anderen Kontinenten hat.
Ausgehend von dieser Annahme müssen wir uns fragen, ob dies der ernsthafteste und richtigste Weg ist, die Biennale von Venedig in die laufenden Prozesse der kulturellen Dekolonisierung einzubeziehen. Mit anderen Worten: Ist es wirklich sinnvoll, eine monolithische Ansammlung von Ausgeschlossenen, Indigenen und Queers nach Venedig zu bringen, und alles andere bis auf wenige Ausnahmen dogmatisch abzuschneiden? Wahrscheinlich nicht, und zwar aus mehreren Gründen. Trotz aller guten Absichten, die die künstlerische Leitung dieser Biennale zweifelsohne antreibt, führt sie, wenn auch unbewusst, zu einer Konfrontationsdynamik, die nicht einmal im Interesse der Ausgegrenzten liegt, die die Ausstellung ins Zentrum rücken will (man erinnere sich an Errico Malatesta: “Die unterdrückten Massen [...] werden sich nur durch die Vereinigung, die Solidarität mit allen Unterdrückten, mit allen Ausgebeuteten der ganzen Welt emanzipieren können”). Eine Dynamik, die, wenn sie in anderen Bereichen und auf anderen Ebenen erlebt wird (denn die bildenden Künste zählen bekanntlich nicht mehr viel oder gar nichts), zwangsläufig - und das zeigt die Realität - die Verstärkung der populistischen, nationalistischen und reaktionären Afflatusse nach sich zieht, die den “Norden der Welt”, um die Terminologie des Kurators dieser Biennale zu verwenden, immer wieder erschüttern. Es ist im Übrigen schwierig, keine Logik der Opposition zu erkennen, wenn man die Kunstgeschichte nicht als einen historischen Prozess versteht, der immer regionale und lokale Verzweigungen hatte und haben wird, sondern als eine Art Abrechnung mit der Vergangenheit, als Rache, als Angriff auf eine Regel. Sie ist auch deshalb nicht nützlich, weil sie in die Gefahr gerät, die Biennale nicht in den Querschnitt der zeitgenössischen Welt zu verwandeln, der sie sein sollte, vielleicht mit dem Anspruch, eine künftige Richtung vorzugeben, sondern in eine Art Filmwelt , die in Räume unterteilt ist, in ein Kompendium von Folklore und handwerklichen Produktionen dessen, was wir einmal die “Dritte Welt” genannt haben, im entsprechenden Ausstellungsformat einer Fotosafari. Dies wurde implizit von der großen Kaviar-Gauche-Farrago zu Hause bestätigt, die bereits während der Preview-Tage in der bunten Ausstellung schwelgte, die ein Kompendium der Tausenden von wunderbaren Handwerkstechniken des globalen Südens bot, und die es nicht versäumte, Instagram mit den Ergebnissen ihres ekstatischen Staunens zu besprühen. Besteht da nicht die Gefahr, eine weitere Furche zwischen dem Westen und dem Rest der Welt zu ziehen? Besteht nicht die Gefahr, dass die Einrichtung einer Vitrine in Venedig, in der eine Reihe von Batiken, Andenstoffen und Schamanenzeichnungen getrennt von allem anderen ausgestellt werden, Stereotypen über diese Künstler schürt? Oder die Marginalität noch deutlicher zu machen, die man gerne aufheben möchte? Besteht nicht die Gefahr, dass die Haltung von Foreigners Everywhere derjenigen der Ethnologen ähnelt, die vor Jahrhunderten ihre Kuriositätenkabinette aufstellten? Und können wir uns dann nicht endlich von der Vorstellung befreien, dass ein fluider Künstler immer noch als “fremd” wahrgenommen werden muss?
Die Begrenztheit von Pedrosas Biennale ergibt sich auch aus den drei ’Historischen Kernen’, drei kleinen Rückblicken auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, einer peinlicher als der andere, konzipiert mit allen Mängeln des zeitgenössischen Kerns. Der erste Historische Kern (wenn man den Rundgang im Arsenale beginnen möchte), Italiani ovunque, wie es im Katalog heißt, “versammelt Werke italienischer Künstler, die ins Ausland gereist sind und dort gelebt haben und ihre Karriere in Afrika, Asien und Lateinamerika sowie in den Vereinigten Staaten und Europa entwickelt haben”, "italienische Immigranten der ersten und zweiten Generation, die im Laufe des 20. Die Kriterien für die Auswahl sind nicht ganz klar, denn neben den Künstlern, die Italien tatsächlich verlassen haben, um sich dauerhaft an einem anderen Ort niederzulassen, gibt es auch solche, die wie Galileo Chini gerade lange genug in Thailand geblieben sind, um ein Werk zu vollenden. Er blieb gerade lange genug, um ein Werk zu vollenden, das er dort in Auftrag gegeben hatte (es ist merkwürdig, dass Chinis einziges Werk vor Ort , die Fresken, die die Kuppel des zentralen Pavillons in den Giardini schmücken, im Dunkeln gelassen wurde: nicht einmal ein Minimum an Respekt für einen der ausgewählten Künstler). Aber abgesehen von den Gründen für die Auswahl ist der Nucleus nichts weiter als eine Art Stickeralbum, das einen ganzen Raum einnimmt, ein unförmiges Gewimmel von unverbundenen Künstlern, ein undeutliches Durcheinander, das oft zutiefst unterschiedliche Erfahrungen versammelt, und nicht einmal das Schönenicht einmal der schöne Rahmen (die cavalete de cristal, die transparenten Schaufenster , die Lina Bo Bardi 1968 für das MASP in São Paulo entwarf, das Museum, das jetzt von Pedrosa geleitet wird) schafft es, die Ergebnisse einer sehr schlechten Ausstellung zu beleben.
Nicht besser sieht es mit den beiden historischen Zentren der Giardini aus, dem der Abstraktion gewidmeten und dem der Porträts, die beide von der Absicht beseelt sind, den Niedergang der Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts zu beobachten, dargestellt von Künstlern, die weit entfernt von den Kontinenten arbeiteten, in denen die Avantgarden entstanden. Auch hier gibt es keinen anderen historischen Rahmen als den Wunsch zu zeigen, dass es im Gefolge dessen, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den treibenden Zentren Europas und Nordamerikas produziert wurde, in der übrigen Welt diejenigen gab, die ihren eigenen Beitrag leisteten und die Anregungen aus anderen Zentren lokal weiterentwickelten. So ist es in der Kunstgeschichte immer gewesen: Die Renaissance wurde in Florenz geboren, aber es gab auch eine lombardische Renaissance, eine Renaissance von Urbino, eine ligurische Renaissance und so weiter, jede mit ihrem eigenen Temperament und ihrem eigenen originellen Charakter. Kein seriöser Kunsthistoriker käme jedoch auf die Idee, eine Ausstellung in einem einzigen Raum zu veranstalten, in dem ein Boltraffio, ein Fra’ Carnevale, ein Ludovico Brea usw. verstreut sind, ohne dem Besucher über einige biografische Angaben zu den ausgestellten Künstlern hinaus eine Art Orientierung zu bieten. Denn das ist die Situation, vor der der Besucher steht, wenn er durch die beiden historischen Kerne der Gärten geht: Ein unverständlicher Überblick über afrikanische, lateinamerikanische und asiatische Künstler des frühen 20. Jahrhunderts, ohne Kriterien, ohne Führer (es gibt nur Kurzbiografien), ohne klare Unterteilung, in einer verwirrenden Masse, in der es keine Unterscheidung zwischen sogar radikal unterschiedlichen Kontexten gibt, in der die wirklich originellen Künstler, wie Tarsila do Amaral oder Candido Portinari in der Porträtabteilung, unter zweit- und drittklassigen Malern untergehen, mit dem Risiko, dass der Besucher sie am Ende verliert. Die Historischen Kerne sind also auch eine verpasste Gelegenheit.




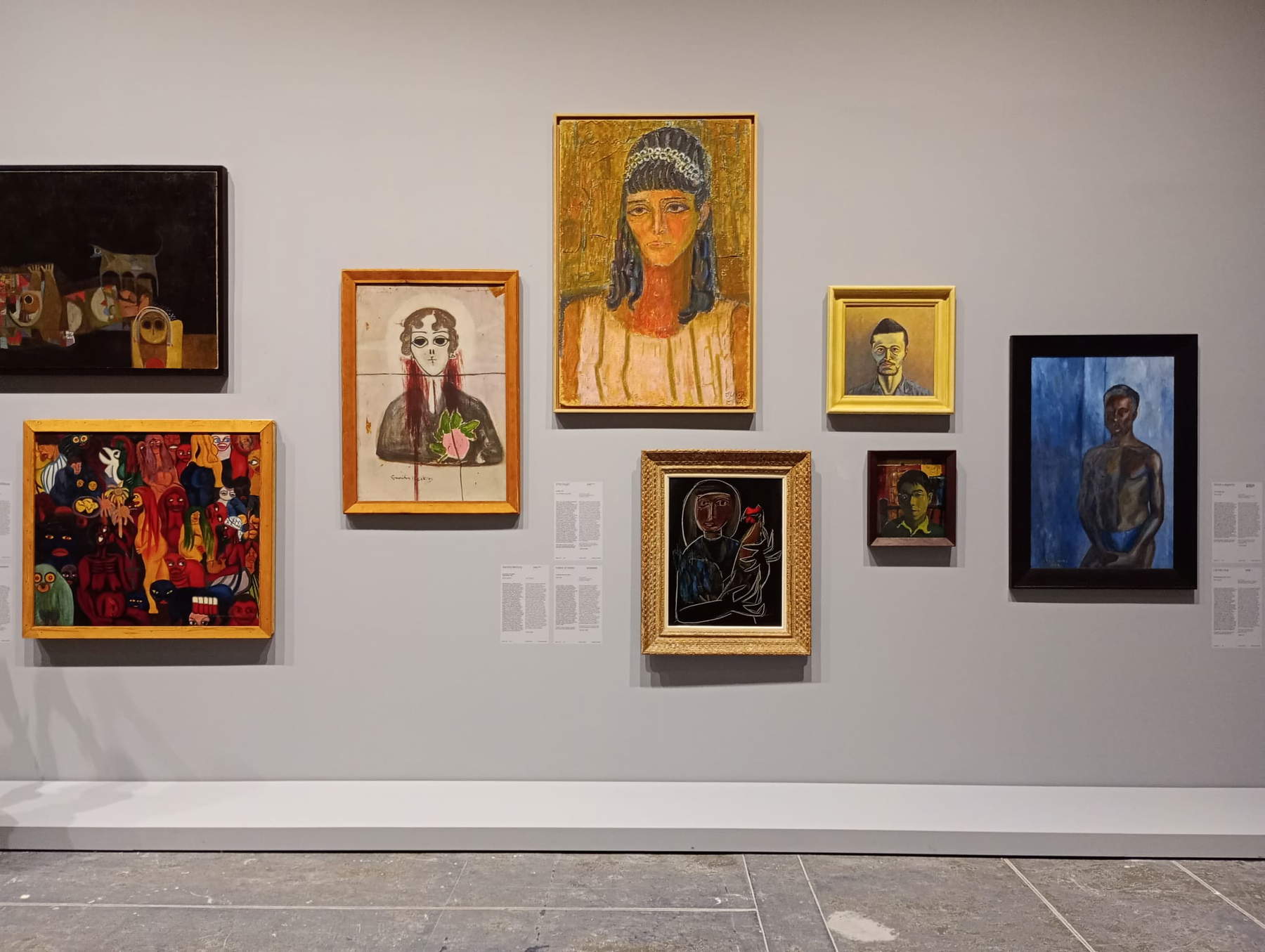
Es mag paradox erscheinen, aber es herrschte ein frischerer Wind auf der von Ralph Rugoff kuratierten Biennale, die wir vielleicht nicht als eine der besten Ausgaben der Geschichte in Erinnerung haben, aber es war die letzte, bei der die Leitung Künstler aus dem “Norden” und dem “Süden” ohne Ghettoisierung und Kapitulation zusammenbrachte. Es war die letzte, bei der die Leitung Künstler aus dem “Norden” und dem “Süden” ohne Ghettoisierung und ohne die Logik eines Kräftemessens zusammenbrachte, indem sie die künstlerischen Produkte des Westens und die des Rests der Welt auf die gleiche Ebene stellte, mit dem gemeinsamen Ziel, eine Vision der Welt anzubieten und zu versuchen, eine Hypothese über den Weg zu entwickeln. Es ist nicht sicher, dass die Hypothese über die Zukunft dann richtig ist, es ist nicht sicher, dass die Zeiten den Vorstellungen eines Kurators nicht widersprechen, aber zumindest in der Vergangenheit wurde den Besuchern die Möglichkeit geboten, über eine Richtung zu diskutieren. Heute muss man, um in Venedig einen visionären künstlerischen Vorschlag zu finden, außerhalb der Biennale gehen und sich Pierre Huyghes kraftvolle Ausstellung in der Punta della Dogana ansehen, denn Stranieri ovunque - Foreigners Everywhere ist eine harmlose, leutselige, axiomatische, nicht sehr prägnante, bestenfalls zusammenfassende Ausstellung.
Die letzten beiden Biennalen waren eher darauf bedacht, einen bestimmten Geschmack zu treffen, sie haben sich auf die Suche nach Antithesen begeben, sie haben sich in Diskussionen eingemischt, die bereits anderswo begonnen wurden, ohne dabei besonders interessante Beiträge zu liefern. Im Gegenteil, die Biennale 2024 hat wahrscheinlich einen Rückschritt sanktioniert, da die diesjährige internationale Ausstellung eine Idee der Dekolonisierung aufzwingt, die fast jede Form des Dialogs außer Acht zu lassen scheint. Schließlich ist es Pedrosa selbst, der in seinem Interview mit Julieta González erklärt, dass der Sinn und Zweck der beiden historischen Kerne der Giardini darin besteht, “den westlichen Kanon herauszufordern”. Und die Idee der Entkolonialisierung als Herausforderung des Westens ist im Übrigen eine Idee, die in der Illusion, ein Problem zu lösen, am Ende andere schafft: Jason Farago hat in der New York Times zu Recht auf die Nahtstellen zwischen dieser Art von Narrativ und der antikolonialen Rhetorik eines Putin hingewiesen, der versucht, sein Russland als Freund afrikanischer Länder darzustellen, während er gleichzeitig versucht, der Ukraine seinen eigenen Imperialismus außerhalb der Geschichte aufzuzwingen. Das ist also nicht wirklich die kulturelle Entkolonialisierung, die wir brauchen.
Gibt es jedoch eine andere Möglichkeit? Sicherlich, und sie ist in einigen der nationalen Pavillons zu finden (auch wenn es nicht viele gibt, die über eine bloße Präsentation der Ausgeschlossenen im eigenen Land hinausgehen): in dem von Frankreich zum Beispiel, wo Julien Creuzet mit einem von Poesie durchdrungenen Gesamtwerk darauf hinweist, dass der Prozess der Entkolonisierung als ein Moment des Überdenkens nicht nur unserer politischen Strukturen, sondern auch unserer Positionierung in der Welt gedacht werden sollte. Dekolonisierung also als Umstrukturierung und nicht als Herausforderung oder Abrechnung. Andernfalls können wir weiterhin glauben, dass wir das Unsere getan haben, indem wir uns mit ein paar exotischen Naivlingen begnügen. Der Ausschuss von vor fünfzig Jahren hätte sich wahrscheinlich gefreut.
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.



























