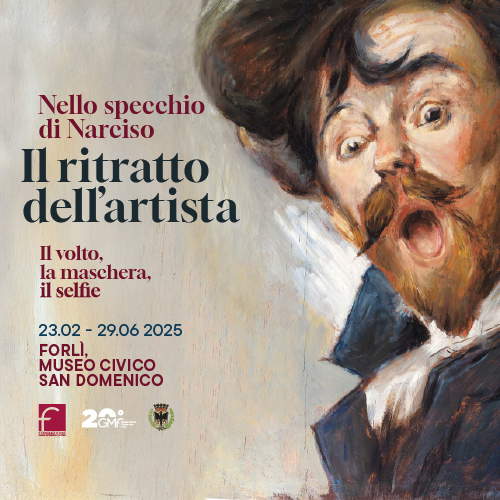Im MAO in Turin erzählt eine Ausstellung von Japan anhand von Männerkleidung aus dem frühen 20.
DasMAO Museo d’Arte Orientale in Turin präsentiert vom 12. April bis 7. September 2025 die Ausstellung Haori. Männerkleidung aus dem frühen 20. Jahrhundert erzählt von Japan. Das Ausstellungsprojekt wurde dank der kuratorischen Beratung von Silvia Vesco (Dozentin für Geschichte der japanischen Kunst an der Universität Ca’ Foscari in Venedig), Lydia Manavello und You Mi (unabhängige Kuratorin und Dozentin für Kunst und Wirtschaft an der Universität Kassel) in Zusammenarbeit mit dem Direktor des MAO, Davide Quadrio, und den Kuratorinnen Anna Musini und Francesca Filisetti mit der Unterstützung von Francesca Corrias realisiert. Zu diesem Anlass werden etwa fünfzig Haori und Juban - Überkimonojacken bzw. Gewänder unter Herrenkimonos - sowie eine Auswahl an traditioneller Kinderkleidung aus der Sammlung Manavello ausgestellt. Diese werden in einen Dialog mit Installationen zeitgenössischer Künstler gestellt.
Es handelt sich um eine Ausstellung, die bisher weder in Italien noch in Europa zu sehen war und somit ein absolutes Novum im Rahmen der Ausstellungen über die Kunst des Fernen Ostens darstellt.
Die Verzierungen auf den ausgestellten Kleidern sind nicht nur Beispiele feiner Handwerkskunst, sondern echte Dokumente und Zeugnisse, die die Geschichte Japans zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählen . Jahrhunderts erzählen. In dieser Zeit, die durch tiefgreifende soziale, politische und kulturelle Veränderungen gekennzeichnet war, kam es zu einer beschleunigten Modernisierung, die von imperialistischen Spannungen begleitet wurde. In der Ausstellung werden Werke zeitgenössischer Künstler zu Instrumenten der Analyse und Reflexion, die dem Besucher helfen, sich in einer komplexen historischen Periode zurechtzufinden, die von den komplizierten Beziehungen zwischen Japan, China und Korea geprägt war und in Italien noch wenig bekannt ist.

Eine Reise durch Traditionen und verborgene Bedeutungen
Die japanische Kultur, die in einer Philosophie verwurzelt ist, die das Andeuten dem Enthüllen vorzieht, findet ihr Gleichgewicht in der Abwechslung von festen und leeren Flächen, in der ständigen Suche nach Harmonie. Die Kleidung spielt eine grundlegende Rolle bei der Definition der sozialen Räume und Hierarchien des Landes, aber während die Kimonos der Frauen seit langem Gegenstand von Studien und Bewunderung sind, wurde die Kleidung der Männer noch wenig untersucht.
Obwohl sie weniger auffällig ist, ist die Männerkleidung ein wesentlicher Bestandteil der reichen Textilwelt Japans. Ob es sich um die Strenge eines zeremoniellen Kleides oder die schlichte Eleganz eines Alltagskimonos handelt, diese Kleidungsstücke bewahren eine Welt, die sich nur im häuslichen Bereich oder in intimen Momenten offenbart. Die dekorativen Elemente im Inneren der Jacken oder auf den Unterkimonos erzählen verführerische und erzählerische Geschichten durch raffinierte Motive, die kunstvoll gewebt oder gemalt sind. Die dargestellten Themen reichen von der Literatur bis zur Kriegskunst, von der Natur bis zur Spiritualität und bieten einen faszinierenden Einblick in die japanische Kultur.
Mode, Politik und kulturelle Identität
Die ausgestellten Haori und Juban, die traditionell als Kleidungsstücke der alltäglichen Intimität galten, erhalten eine neue Bedeutung und werden zu Instrumenten der Reflexion über hochaktuelle Themen, darunter Fragen im Zusammenhang mit der japanischen Expansion nach Asien im 20. Jahrhundert und den politischen und sozialen Auswirkungen, die den historischen Kontext prägten. Dazu gehört auch die Propaganda, die nicht nur von den traditionellen Medien, sondern auch von der Kleidung selbst ausgeht, wobei die Ausstellung auch der Kinderkleidung besondere Aufmerksamkeit widmet.
Die Ausstellung erforscht somit die im Westen verbreitete Vorstellung von Japan, die oft noch mit einer romantischen und traditionellen Vision verbunden ist, im Gegensatz zu einer weniger bekannten Perspektive, die sich gerade in der Männerkleidung zeigt. Die Verzierungen auf der Kleidung bringen sowohl den Mythos des Westens als auch einen starken japanischen Nationalstolz zum Ausdruck, der in der technologischen Entwicklung und der mühsamen Verteidigung der eigenen Identität vor und während des Zweiten Weltkriegs gipfelte.
Dieses kulturelle Erbe ist noch lange nicht verschwunden und lebt nicht nur in Japan, sondern auch in den Ländern weiter, die von ihm beeinflusst wurden. Die zeitgenössischen Installationen und Videos in der Ausstellung bieten greifbare Beweise für dieses Fortbestehen und bereichern die Erzählung mit Einblicken in die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Zeitgenössische Kunst und globale Perspektiven
Die Ausstellung umfasst Werke von internationalen Künstlern, die sich mit Themen wie persönliche und kollektive Identität, Nomadentum und Migration auseinandersetzen. Das Video A Needle Woman und die Skulpturen Bottari von Kimsooja (Taegu, Korea, 1957) analysieren das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, betonen kulturelle und sprachliche Mischformen und zeigen auf, wie Nomadentum und Migration die persönliche und kollektive Identität prägen.
Die große Installation Kotatsu (J. Stempel) von Tobias Rehberger (Esslingen, Deutschland, 1966) verbindet zwei weit entfernte Traditionen - die japanische und die deutsche -, um über die Konzepte von Tod und Verwandlung zu reflektieren.
Das Video Kishi the Vampire von Royce Ng (Hongkong, 1983) interpretiert die Geschichte des japanischen Premierministers Kishi Nobusuke (im Amt von 1957 bis 1960) durch eine vampirähnliche Erzählung neu und bietet eine neue Perspektive auf die politische Wirtschaft Japans im Verhältnis zu China und Korea im 20. Dieses Werk findet ein Echo in dem Film Tungus 通古斯 von Wang Tuo (Changchun, China, 1984), der historische Dokumente, kulturelle Archive, Fiktion und Mythologie zu einer spekulativen Erzählung verbindet.
Im Einklang mit dem Programm des MAO ist die Ausstellung als ein lebendiger Organismus konzipiert. Während ihrer gesamten Dauer wird sie durch ein Programm mit Performances und Musik bereichert, das von Chiara Lee und Freddie Murphy kuratiert wird.
Ein Katalog zur Ausstellung, der in italienischer und englischer Sprache erhältlich ist, mit bisher unveröffentlichten kritischen Essays und einem umfangreichen ikonografischen Apparat, wird im Juni 2025 von Silvana Editoriale veröffentlicht.
Für alle Informationen: www.maotorino.it

 |
| Im MAO in Turin erzählt eine Ausstellung von Japan anhand von Männerkleidung aus dem frühen 20. |
Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.